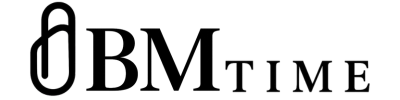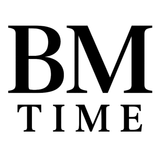Generation Z und die Politikverdrossenheit - Warum junge Menschen anders denken

Die Generation Z – jene, die zwischen etwa 1995 und 2010 geboren wurden – wächst in einer Zeit auf, in der Krisen zur Normalität geworden sind: Klimawandel, Pandemie, Kriege, Inflation. Doch während viele Jugendliche und junge Erwachsene lautstark für ihre Anliegen auf die Straße gehen, sinkt zugleich ihr Vertrauen in Parteien, Parlamente und politische Institutionen. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
Zwischen Engagement und Enttäuschung
Die Generation Z gilt als hochpolitisch, aber parteienfern. Studien des Deutschen Jugendinstituts und der Shell-Jugendstudie zeigen: Das Interesse an gesellschaftlichen Fragen ist groß – insbesondere bei Themen wie Klimaschutz, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit. Dennoch fühlen sich viele junge Menschen von der klassischen Politik nicht repräsentiert.
„Junge Menschen haben ein starkes Bedürfnis, etwas zu verändern, aber sie sehen in den etablierten Strukturen kaum Möglichkeiten dazu“, erklärt der Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Politik werde als zu langsam, zu abstrakt und zu weit weg vom Alltag erlebt. Während ältere Generationen eher auf langfristige Prozesse und Kompromisse setzen, erwartet die Gen Z sichtbare, schnelle Ergebnisse.
Digitale Welt, andere Werte
Ein zentraler Unterschied liegt in der Kommunikationskultur. Die Gen Z ist in einer digitalisierten Welt sozialisiert, in der Informationen sofort verfügbar sind und Diskurse in Echtzeit stattfinden. Plattformen wie TikTok, Instagram oder X (vormals Twitter) prägen, wie politische Themen wahrgenommen werden.
Das führt zu einer neuen Form der Politisierung: Statt über Parteiprogramme informieren sich viele über Influencer, Memes oder Kurzvideos. Studien der Universität Hohenheim zeigen, dass Jugendliche eher auf Social Media über Politik sprechen als in klassischen Medien. Der Nachteil: Komplexe Sachverhalte werden dort oft verkürzt oder emotionalisiert dargestellt – was die Distanz zu traditionellen politischen Formen weiter verstärkt.
Misstrauen in Institutionen – aber nicht in Werte
Laut einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung vertraut nur rund ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen den politischen Institutionen. Gleichzeitig bekennen sich über 80 Prozent zu demokratischen Werten wie Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und sozialer Verantwortung. Die Politikverdrossenheit der Gen Z ist also kein Desinteresse an Demokratie, sondern Ausdruck einer Frustration über deren Umsetzung.
Viele junge Menschen bevorzugen direkte Beteiligungsformen – Petitionen, Bürgerinitiativen, Klimastreiks. Sie wollen mitgestalten, statt passiv alle vier Jahre wählen zu gehen. Parteien, die auf diese Erwartungen nicht eingehen, verlieren an Bindungskraft.
Was Politik jetzt lernen muss
Politikwissenschaftler fordern, die Kommunikation mit jungen Menschen neu zu denken. Statt Wahlwerbung und Parolen brauche es echten Dialog auf Augenhöhe. Projekte wie Jugendparlamente, digitale Beteiligungsplattformen oder politische Bildungsarbeit in Schulen könnten helfen, das Vertrauen zurückzugewinnen.
Zugleich liegt die Verantwortung nicht allein bei der Politik: Auch Medien, Bildungseinrichtungen und soziale Netzwerke prägen das politische Bewusstsein der Jugend. „Wenn wir wollen, dass junge Menschen demokratische Prozesse verstehen und mitgestalten, müssen wir ihnen Raum dafür geben“, so die Politikwissenschaftlerin Prof. Ulrike Ackermann.
Ausblick
Die Generation Z ist nicht politikverdrossen – sie ist politikverändernd. Sie fordert neue Wege, neue Formen der Teilhabe und mehr Authentizität von denjenigen, die über ihre Zukunft entscheiden. Ob es gelingt, diese Energie in stabile politische Strukturen zu überführen, wird entscheidend dafür sein, wie demokratisch Deutschland in den kommenden Jahrzehnten bleibt.